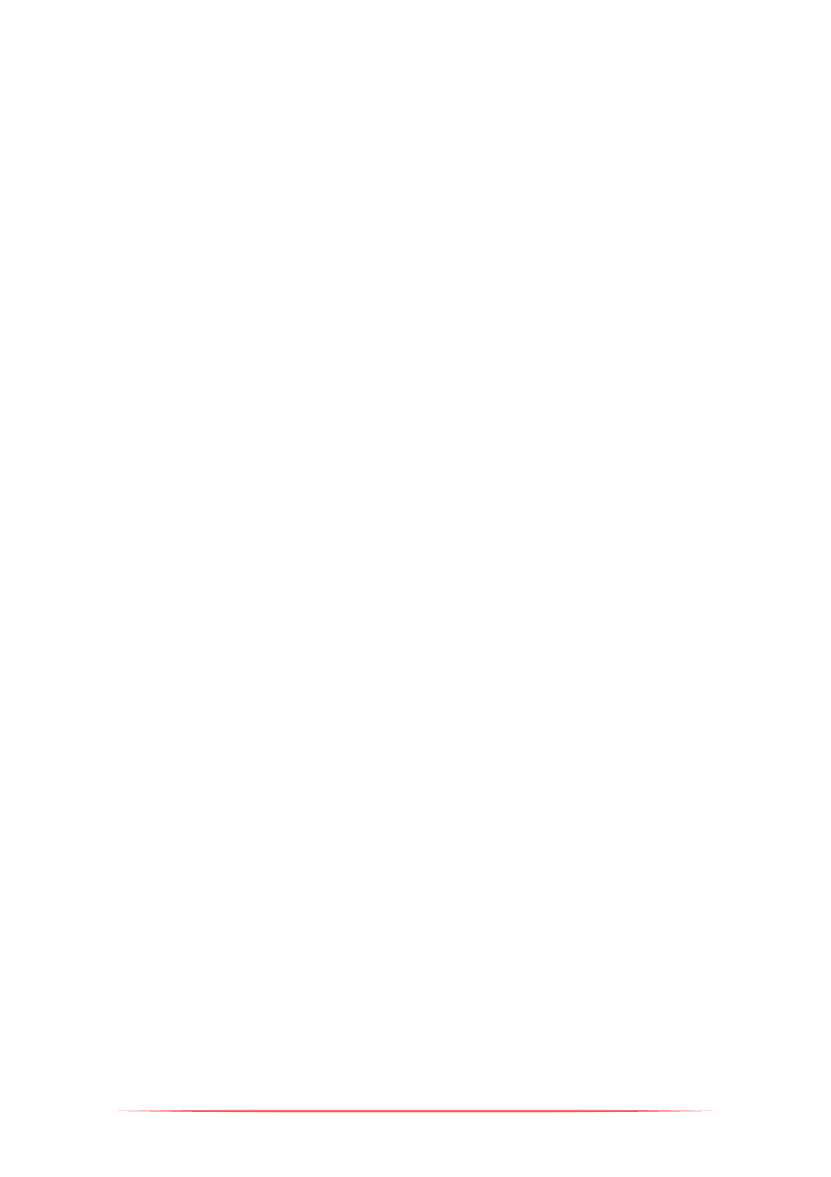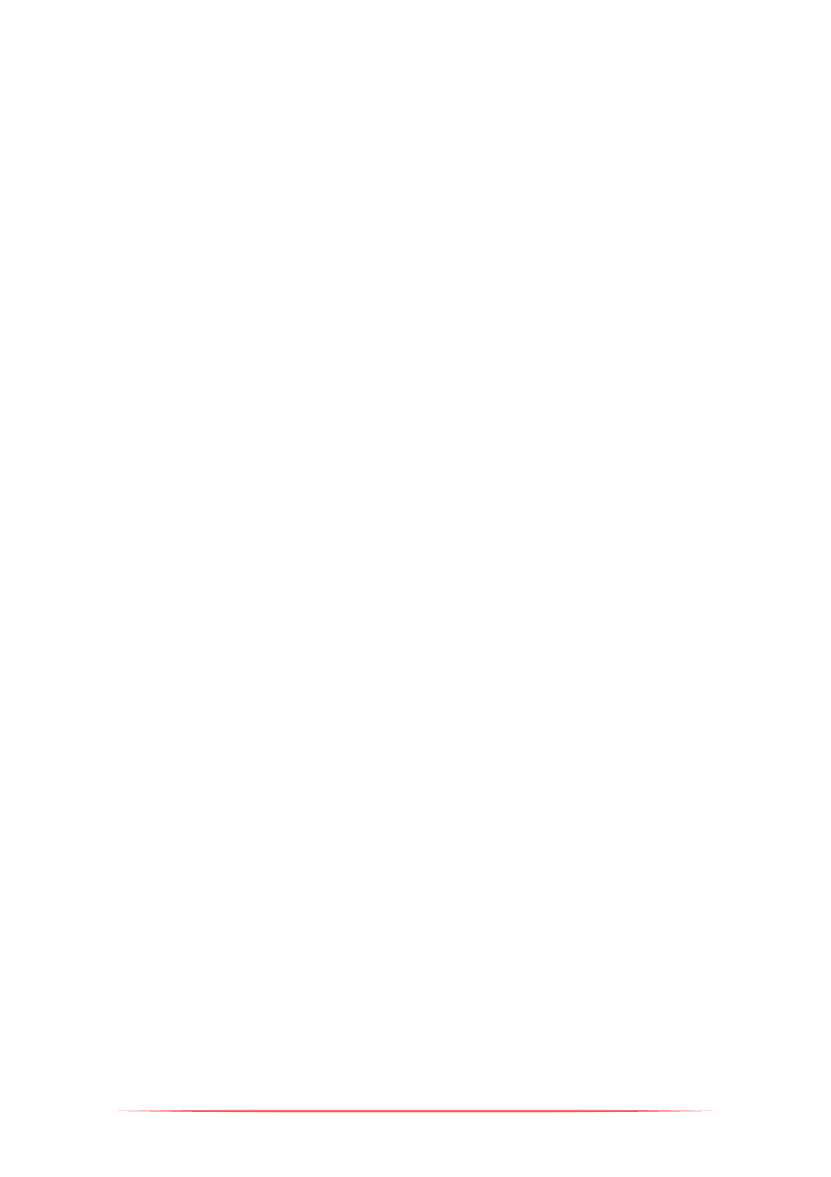
46
manche bedenklichen Nebenwirkungen – so gibt es eine frühe
Auslese nach sozialer Herkunft, nach Verhaltensstörungen,
nach anfänglich mitgebrachter Lernmotivation. Die Anre-
gungswirkung ungruppierter Klassen auf schwächere Schüler
wird abgeschnitten. Günstiger ist dagegen eine auf je einzelne
Fächer bezogene Leistungsgruppierung, wie sie etwa als sog.
Kern- und Kurssystem in vielen deutschen Gesamtschulversu-
chen praktiziert wird“ (H
ECKHAUSEN
1974, S. 584).
Als Organisationsform dieser fachbezogenen „Leistungsgrup-
pierung“ als äußere Differenzierung nennt H
ECKHAUSEN
(1968,
S. 213) die „Tüchtigkeitsgruppen.“ Diese hatte ich 1979 an der
Bodensee-Schule in Friedrichshafen noch vorgefunden: als A-,
B- und C-Kurse in den Hauptfächern. Kinder, die dem C-Kurs-
Englisch zugeordnet waren, hatten allerdings nie mehr die
Chance, einen anderen Kurs zu erreichen, sie hörten nie mehr
anderes Englisch als das ihrer gleich schwachen Mitschüler
bzw. das des oft fachfremd unterrichtenden Lehrers (die „gu-
ten“ Englisch-Lehrer bekamen selbstredend den A-Kurs!). Mit
dem christlichen Menschenbild war diese Praxis schwer ver-
einbar, sie wurde auch bald beendet.
H
ECKHAUSEN
sieht die Grenzen dieses Systems ebenfalls: „Aber
auch hier ist es kaum möglich, für eine größere Gruppe Schü-
lern eine optimale Passung zu erzielen, ohne dass einige von
dem gleichen Unterrichtsangebot unterfordert und andere
überfordert werden. Gegenwärtig sucht man deshalb nach
zusätzlichen und praktikablen Formen der sog. „inneren Diffe-
renzierung“, d. h. nach Möglichkeiten, die den Schülern selbst
die Wahl des von ihnen bevorzugten Schwierigkeitsgrades
und Lerntempos freistellen und die selbstgesteuerte Bildung
kleinerer Gruppen im Klassenverband erlauben“ (1974,
S. 584).